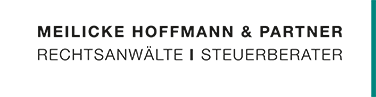Newsletter
Kündigung eines Vorstands wegen DSGVO-Verstoßes – OLG München konkretisiert Legalitätspflicht und Beginn der Kündigungs-Ausübungsfrist
Das Oberlandesgericht (OLG) München hat mit Urteil vom 31. Juli 2024, 7 U 351/23 e, klargestellt: Die Weiterleitung dienstlicher E-Mails mit personenbezogenen Daten an eine private E-Mail-Adresse kann eine Verletzung der Legalitätspflicht darstellen und zur fristlosen Kündigung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem Grund berechtigen. Zugleich konkretisiert das Urteil, wann die Ausübungsfrist zur Kündigung zu laufen beginnt.
Sachverhalt
Der Kläger war bis September 2021 Vorstand einer nicht börsennotierten AG. Über zwei Monate (April und Mai 2021) hinweg leitete er insgesamt neun dienstliche E-Mail-Korrespondenzen mit sensiblen Inhalten (z. B. Gehaltsabrechnungen, interne Organisationsfragen, geldwäscherechtliche Vorgänge) in Kopie („CC“) an seine private E-Mail-Adresse weiter. Zwei dieser E-Mails gingen auch an ein Mitglied des Aufsichtsrats.
Die Weiterleitungen wurden Ende September 2021 zufällig bei der Durchsicht von Unterlagen durch ein neu bestelltes Vorstandsmitglied entdeckt. Dem Kläger wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Er erklärte, er habe lediglich den Überblick über wesentliche Vorgänge behalten wollen, insbesondere, falls er sich in Zukunft gegen Schadensersatzansprüche verteidigen müsse. Der Aufsichtsrat beschloss weniger als zwei Wochen später, den Kläger mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund abzuberufen und den Vorstandsvertrag fristlos zu kündigen.
In erster Instanz hielt das Landgericht (LG) München I die Abberufung für wirksam, die fristlose Kündigung jedoch für unwirksam. Das OLG München entschied davon abweichend, dass auch die fristlose Kündigung wirksam war.
Wesentliche Entscheidungsgründe
Das OLG München stellte klar, dass die Kündigung innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 626 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erklärt wurde. Zur Bestimmung des Fristbeginns übertrug es dabei die zur GmbH entwickelten Grundsätze. Es komme auf die Kenntnis des Kollegialorgans und nicht auf die Kenntnis einzelner Organmitglieder an. Maßgeblich sei der Zeitpunkt, zu dem der Aufsichtsrat als Kollegialorgan in einer Aufsichtsratssitzung Kenntnis erlange. Das abzuberufende Mitglied des Vorstands werde dadurch geschützt, dass die Einberufung der nächsten Aufsichtsratssitzung nicht unangemessen verzögert werden dürfe. Dies gelte insbesondere, wenn einberufungsberechtigte Mitglieder des Aufsichtsrats Kenntnis von den Kündigungsgründen hätten oder sich der Kenntnisnahme gleichsam verschlössen.
Dass ein Aufsichtsratsmitglied im April/Mai 2021 zwei der E-Mails empfangen habe und durch eine Prüfung des Verteilers hätten erkennen können, dass die E-Mails auch an die private E-Mail-Adresse des Klägers verschickt wurden, sei unerheblich. Das OLG ging davon aus, dass die Aufsichtsratsmitglieder ihren Fokus auf den Inhalt der Nachrichten – und nicht auf den Verteiler – richteten, zumal es keine Anhaltspunkte gab, die eine genaue Prüfung des Verteilers geboten hätten.
Den wichtigen Grund zur Kündigung leitete das OLG aus einem Verstoß gegen die Legalitätspflicht ab. Das Weiterleiten der E-Mails stelle eine unzulässige Datenverarbeitung i.S.d. Art. 4 Nr. 2, 6 DSGVO dar, die auch nicht dadurch gerechtfertigt werde, dass der Kläger nach seiner Ansicht eine „Beweissicherung“ bezweckte. Der Kläger betonte im Verfahren, nur solche E-Mails weitergeleitet zu haben, die „unentbehrlich waren, um später beweisen zu können, dass er selbst keine zur Haftung führenden Fehler begangen hat“. Das OLG sah, wie schon das LG, hierzu keine Veranlassung. Dem Kläger stünde aus § 810 BGB ein Einsichtsrecht zu, soweit er Unterlagen der Gesellschaft zur Verteidigung gegen etwaige Schadensersatzansprüche benötigen sollte.
Stellungnahme
Das Urteil zeigt, wie schnell ein vermeintlich harmloser Datenschutzverstoß zu erheblichen Konsequenzen führen und gerade auch die Vorstandsebene betreffen kann. Die Weiterleitung dienstlicher E-Mails an private E-Mail-Adressen stellt im Arbeitsrecht bereits einen der „Klassiker“ für das Vorliegen eines wichtigen Grundes für eine Kündigung dar.
Aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive erfreulich ist, dass das OLG realistische Anforderungen an das „Kennenmüssen“ des wichtigen Grundes auf Seiten der Aufsichtsratsmitglieder gestellt hat. Es wäre lebensfremd zu fordern, dass bei einer E-Mail mit teilweise umfangreichen Verteilern jede E-Mail-Adresse geprüft und dann auch zugeordnet werden kann.
RA Leander Albrecht / WissMit Philippe Keller
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 6/25
Drucken | Teilen