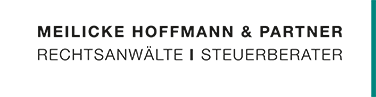Newsletter
BGH: Doch noch keine Klarheit über Geschäftsleiterhaftung für Kartellbußgelder
Gespannt war sie erwartet worden, die Entscheidung des Kartellsenats des BGH zur äußerst kontroversen Frage, ob Geschäftsführer und Vorstände für Bußgelder haften, die gegen ihre Unternehmen wegen eines Kartellrechtsverstoßes verhängt wurden (vgl. Newsletter 1/25: „BGH-Kartellsenat entscheidet äußerst kontroverse gesellschaftsrechtliche Frage“). Der BGH hatte am 11. Februar 2025 sehr ausführlich verhandelt. Und entschied noch am selben Tage und gab dazu eine Presseerklärung heraus: Der BGH entschied noch immer nicht selbst in der Sache; vielmehr legte er dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vor, ob Europäisches Recht einer nationalen Regelung entgegenstehe, „nach der ein Unternehmen, gegen das ein Bußgeld wegen eines Kartellrechtsverstoßes verhängt worden ist, seine Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder dafür in Regress nehmen kann“. Vier Monte und damit ungewöhnlich lange dauerte es danach, seitdem man auf der BGH-Homepage den Wortlaut der Entscheidung (KZR 74/23) nachlesen kann. Da lässt der BGH zwar mit allem Recht keinen durchgreifenden Zweifel daran, dass nach deutschem Recht Geschäftsleiter für aufgrund ihres Fehlverhaltens verhängte Kartellbußen ihrem Unternehmen Schadensersatz leisten müssen. Doch das zu entscheiden, sieht sich der BGH durch Europarecht gehindert. Er meint, für die Beantwortung der Frage der Haftung sei erheblich, ob das Unionsrecht eine einschränkende Auslegung der deutschen Haftungsvorschriften gebiete.
Die wesentlichen Gründe der Entscheidung
Nach den deutschen Haftungsvorschriften haften Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, der Gesellschaft für den entstandenen Schaden (§ 43 Abs. 2 GmbHG und § 93 Abs. 2 Satz 1 AktG). Unstreitig war im BGH-Fall, dass die Beteiligung des beklagten Geschäftsleiters und seiner Gesellschaft an einem nach Europäischen Recht (Art. 101 AEUV) verbotenen Preiskartell eine vorsätzliche Pflichtverletzung und der klagenden Gesellschaft aufgrund des gegen sie verhängten Bußgelds ein Schaden entstanden war. Der BGH lässt klar erkennen, dass er daher nach deutschem Recht die Haftung der Geschäftsleiter für von ihnen zu verantwortende Kartellbußen bejahen würde: Weder der Wortlaut der einschlägigen Haftungsnormen von GmbHG und AktG noch andere Vorschriften des nationalen Rechts verhinderten oder beschränkten den Anspruch der Gesellschaft auf Ersatz ihres Schadens aufgrund gegen sie verhängter Kartellbußen. Anders sei es in Österreich, wo es eine spezielle Regelung (§ 11 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) gibt, die bei Sanktionen gegen Gesellschaften einen Rückgriff auf Entscheidungsträger und Mitarbeiter ausschließt. Die Haftung des Leitungsorgans für gegen ihre Gesellschaft verhängte Bußgelder stehe zudem in Einklang mit Sinn und Zweck der Organhaftung. Der BGH nennt dafür als zentralen Grund ihre Funktion der vermögensrechtlichen Kompensation. Dabei bleibt der BGH nicht stehen: Die Haftungsvorschriften setzten im Interesse des Gesellschaftsvermögens aufgrund des den Leitungsorganen drohenden Haftungsrückgriffs „verhaltenssteuernde Anreize für eine sorgfaltsgemäße und gesetzestreue Unternehmensführung“. Das wirke der Schadensentstehung bereits im Vorfeld entgegen, Der BGH resümiert: „Die Schadensersatzpflicht der Leitungsorgane trägt damit zur Verhinderung von Kartellverstößen bei.“ (Rn. 19 der Entscheidung)
Daher verwirft der BGH in Literatur und Rechtsprechung mitunter zu lesende Forderungen, auf Basis deutschen Rechts die Schadensersatzhaftung der Leitungsorgane für kartellbußgeldrechtliche Sanktion gegen ihre Unternehmen auszuschließen oder einzuschränken. Die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung habe dem deutschen Recht auch sonst kein Verbot entnommen, Geldstrafen oder Bußgeldern auf Dritte abzuwälzen. Der staatliche Strafanspruch sei durch die Bezahlung der Strafe erfüllt. Entscheidend für die Zulässigkeit der Abwälzung ist nach dem BGH nur, dass sich der „Ersatzanspruch aus den allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts ergibt“. So könne zB ein Mandant einen Schadensersatzanspruch gegen seinen Berater auf Erstattung einer gegen ihn verhängten Geldstrafe haben. Der BGH konstatiert zwar, die Inanspruchnahme des Leitungsorgans wegen eines gegen die Gesellschaft verhängten Bußgelds könne die Gesellschaft entlasten. Das könne mit den Zielen kartellrechtlicher Sanktionen in Konflikt geraten. Der BGH lässt aber letztlich offen, ob das zwingend Regressansprüche der Gesellschaft gegen das Leitungsorgan ausschließe. Das für ihn ganz offenbar entscheidende Gegenargument gegen einen solchen Haftungsausschluss nach deutschem Recht formuliert der BGH so: „Soweit mit dem Verbandsbußgeld Wirtschaftsteilnehmer abgeschreckt werden sollen, unterstützen die Vorschriften über die Organhaftung diesen Zweck. Da die Leitungsorgane … maßgeblichen Einfluss auf … die Ausgestaltung der internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Kartellverstößen haben …, ergeben sich aus der drohenden Inanspruchnahme wegen der Bußgeldsanktion wichtige Anreize für ein gesetzestreues Verhalten“; die Möglichkeit des Rückgriffs sei daher ein „wichtiges gesellschaftsrechtliches Disziplinierungsinstrument“ (Rn. 35 der Entscheidung). Die Anteilseigner der Gesellschaft verfügten oft nicht über die erforderlichen Einflussmöglichkeiten, um das Verhalten des Leitungsorgans wirksam zu steuern. Der BGH konstatiert daher, leicht verklausuliert: „Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der zivilrechtlichen Schadensersatzhaftung der Leitungsorgane … aufgrund der nationalen Vorschriften über die kartellbußgeldrechtliche Verbandssanktion … begegnet Bedenken.“ (Rn. 19 der Entscheidung).
Die europarechtliche Fragestellung
Daher könnte man meinen – nach deutschem Gesellschaftsrecht alles klar, Haftung zu bejahen. Doch letztlich lässt der BGH die Frage offen. Er bringt entscheidend die europarechtliche Fundierung der Kartellverbote ins Spiel. Der Rückgriff auf das Vermögen des Geschäftsleiters könne vor dem europäischen Rechtshintergrund Sinn und Zweck der Kartellbuße gegen Unternehmen widersprechen; das könnte vielleicht gebieten, die deutschen Haftungsvorschriften einschränkend auszulegen. Die Ausgestaltung der Geldbußen für Kartellverstöße sei zwar Kompetenz der Mitgliedstaaten. Nach der Rechtsprechung des EuGH müssten diese aber sicherstellen, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Geldbußen gegen Unternehmen verhängen können, wenn diese vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 101 AEUV verstoßen“ (Rn. 40 der Entscheidung). Solche Geldbußen sollten rechtswidrige Handlungen (d.h. Kartellverstöße) der Unternehmen ahnden, sie sollten sowohl die betroffenen Unternehmen als auch andere Wirtschaftsteilnehmer von künftigen Kartellrechtsverletzungen abschrecken. Der BGH erwägt aber, die „gebotene Wirksamkeit von Geldbußen gegenüber Unternehmen“ könnte es beeinträchtigen, wenn sich die Gesellschaften von der Last des Bußgelds durch Rückgriff auf Geschäftsleiter (ggf. teilweise) entlasten könnten (Rn. 37 ff. der Entscheidung).
Daher die Vorlage an den EuGH: Letztinstanzliche nationale Gerichte wie der BGH müssen nämlich die Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegen, wenn es bei ihrem Urteil auf eine Auslegung von Europarecht ankommt und die Antwort nicht klar ist (vgl. Newsletter 2/25: „BGH schickt Acting in Concert auf Prüfstand des Europäischen Gerichtshofs – EuGH“). Solche Auslegungszweifel sieht der BGH in Sachen Regress für Kartellbußen: Zwar gebe es keine ausdrücklichen europäischen Vorschriften zur Frage, ob eine juristische Person sein Leitungsorgan wegen des durch ein Kartellbußgeld verursachten Schadens zivilrechtlich auf Ersatz in Anspruch nehmen könne. Daraus zieht der BGH den Schluss: „Insoweit ist unklar, ob Art. 101 AEUV einem solchen Regressanspruch entgegensteht.“ (Rn. 39 der Entscheidung) Der BGH nennt ein weiteres Argument für die Vorlage und zieht eine Parallele zum Steuerrecht: Der EuGH habe zu erkennen gegeben, dass eine Geldbuße „sehr viel von ihrer Wirksamkeit einbüßen (kann), wenn das betroffene Unternehmen berechtigt wäre, sie auch nur teilweise steuerlich abzusetzen“. Daher stelle sich die Frage, ob die Abwälzung der Geldbuße des Unternehmens auf den Geschäftsführer auf Basis gesellschaftsrechtlicher Vorschriften „den Zweck der kartellrechtlichen Geldbuße beeinträchtigt“, wie es in der Presseerklärung heißt. Rn. 41 der Entscheidung behauptet: „Eine solche Verlagerung des dem Verband durch die Sanktion auferlegten wirtschaftlichen Nachteils entfaltet ähnlich entlastende Wirkungen wie die steuerrechtliche Abzugsfähigkeit einer Geldbuße.“.
Einordnung der BGH-Entscheidung
Die Entscheidung des BGH ist äußerst Europa-freundlich. Das Gericht scheint in den Raum stellen zu wollen, dass immer dann, wenn eine EU-Vorschrift etwas nicht ausdrücklich regelt, Raum für eine Vorlage(pflicht) besteht (so anscheinend Rn. 39 der Entscheidung). Da sich das Problem der Ersatzpflicht für Kartellbußen in allen EU-Mitgliedsstaaten stellen kann, ist die dem EuGH gegebene Möglichkeit, EU-weit für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu sorgen, zwar an sich sehr zu begrüßen. Man mag sich aber fragen, ob es nicht etwas kurz gegriffen ist, aus dem Fehlen der ausdrücklichen Regelung die Vorlagepflicht zu schlussfolgern. Das gilt zumal deshalb, da der BGH an anderer Stelle mit allem Recht unterstreicht, dass „dem zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch der Gesellschaft jedenfalls eine zusätzliche präventive und abschreckende Wirkung zukommen kann, die zur Beachtung der Verbote der Art. 101, 102 AEUV durch die handelnden Leitungspersonen beiträgt“ (Rn. 35, 42 der Entscheidung). Daher scheint die Erwägung des BGH von einer Relativierung der Wirksamkeit der staatlichen Kartellbußen durch die Möglichkeit des Organregresses ein etwas einseitiger Blick. Die vom BGH zur Begründung seiner Vorlage auch gezogene Parallele zur unzulässigen steuerlichen Abzugsfähigkeit der Bußen (Rn. 41) überrascht: Denn es ist ein maßgebender Unterschied, ob der Staat die Wirkung einer von ihm verhängten Geldbuße dadurch relativiert, dass er deren steuerliche Abzugsfähigkeit ermöglicht, oder ob das bebußte Unternehmen nach allgemeinen Grundsätzen zivilrechtliche Ersatzansprüche gegen Dritte hat: Im Fall der steuerlichen Abzugsfähigkeit minimiert nämlich der Mitgliedstaat selbst den „Netto“-Betrag der Buße; solches beschränkt ohne Weiteres die Wirkmacht der staatlichen Buße, und das gerät in Konflikt mit der europarechtlichen Forderung nach wirksamen Sanktionen. Einen solchen Konflikt gibt es aber nicht, wenn dem bebußten Unternehmen nach allgemeinem Zivilrecht Schadensersatzansprüche zustehen gegen seine handelnden eigenen Leitungsorgane, die selbst den Kartellrechtsverstoß und damit die Buße / den Schaden der Gesellschaft verschuldet haben. Daher wirkt es allzu vordergründig, wenn der BGH meint, die „Verlagerung“ des der Gesellschaft durch die Kartellbuße auferlegten wirtschaftlichen Nachteils auf Geschäftsleiter „entfaltet ähnlich entlastende Wirkungen“ wie die steuerrechtliche Abzugsfähigkeit der Buße (Rn. 41). Diese Einschätzung des BGH steht in auffälligem Widerspruch zu seiner Beurteilung der D&O-Versicherung, die die Haftungsfolgen für Organmitglieder mindert: Wenn aber, wie es bei Rn. 44 der Entscheidung heißt, insoweit „keine generellen Schlussfolgerungen“ zu ziehen sind, kann man sich schon fragen, warum ein zivilrechtlicher Ersatzanspruch der Gesellschaften gegen ihre Organmitglieder, die die Bußen pflichtwidrig vorsätzlich verschuldet haben, anders zu beurteilen sein soll als andere Ersatzmöglichkeiten etwa über Schadensversicherungen der Unternehmen selbst.
Was vom EuGH zu erwarten ist
Wie der EuGH entscheiden wird, erscheint offen. Selbst wenn er meinen sollte, dass Europarecht dem Regress für verhängte Bußen bei Geschäftsleitern entgegensteht, ist damit für diese häufig nicht allzu viel gewonnen. Denn der BGH stellt mit allem Recht klar, dass die Gesellschaften Ersatzansprüche gegen ihre Geschäftsleiter für Sekundärschäden haben (zB Kosten für die Aufklärung des Sachverhalts sowie Rechtsverteidigung im kartellbehördlichen Ermittlungsverfahren). Der BGH schreibt: „Da der Ersatz dieses Schadens die Wirksamkeit des verhängten Bußgelds nicht beeinträchtigt, dürfte es an einer Grundlage für die Einschränkung des darauf gerichteten Schadensersatzanspruchs … von vornherein fehlen.“ (Rn. 45 der Entscheidung). Allerdings hat der BGH seine Vorlage nicht auf den Aspekt beschränkt, ob Europarecht dem Geschäftsleiterregress in Hinblick auf die Buße als solche entgegensteht. Gefragt hat er allgemein danach, ob Europarecht einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der eine Gesellschaft, gegen die eine nationale Wettbewerbsbehörde ein Bußgeld wegen eines Kartellrechtsverstoßes „verhängt hat, den ihr dadurch entstandenen Schaden von dem Leitungsorgan ersetzt verlangen kann“. Zu dem dadurch entstandenen Schaden wird man zwanglos auch Sekundärschäden zählen können. Der EuGH wird kaum die Möglichkeit ungenutzt lassen, auch insoweit Pflöcke zu setzen. Es bleibt spannend.
Was bedeutet die Entscheidung für die deutsche Unternehmenspraxis?
Unternehmen können nicht abwarten, wie sich die Rechtsprechung weiter entwickelt. Zumal Aktiengesellschaften sind nach der sog. „ARAG/Garmenbeck“-Rechtsprechung des BGH grundsätzlich verpflichtet, Ersatzansprüche gegen ihre Geschäftsleiter durchzusetzen. Nach den klaren Worten des BGH zur deutschen Rechtslage dürfen sie nicht etwa darauf vertrauen, dass die Haftung für Kartellbußen streitig ist. Sondern müssen alles Erforderliche dafür tun, solche Ansprüche zu sichern – zB durch ordentliche Sachaufklärung und ggf. durch wirksam die Verjährung hemmende Maßnahmen.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 5/25
Drucken | Teilen