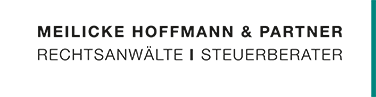Newsletter
Trügerischer Beweiswert einer Notarurkunde
Besonders wichtige Geschäfte bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer notariellen Beurkundung. Das gilt insbesondere für Verträge im Zusammenhang mit Immobilien, aber z.B. auch für viele erbrechtliche Angelegenheiten. Dabei herrscht verbreitet die Auffassung, dass das, was notariell beurkundet wurde, damit unumstößlich feststehe und später grds. nicht mehr angezweifelt werden könne. Das gilt aber tatsächlich nicht für die inhaltliche Richtigkeit einer notariell beurkundeten Erklärung, was oft verkannt wird. Das musste sich nun auch ein Oberlandesgericht vom Bundesgerichtshof (BGH) sagen lassen, der dazu in seinem Urteil vom 28.08.2024 klare Worte gefunden hat (Az. XII ZR 62/22).
Der Sachverhalt und die ersten beiden Instanzen:
Der Kläger, Alleinerbe seiner verstorbenen Großmutter, klagt gegen einen weiteren Enkel, seinen Vetter. Er verlangt von diesem Schadensersatz, weil der als zu Lebzeiten der Erblasserin als deren gerichtlich eingesetzter Betreuer im Jahr 2015 eine Immobilie (Eigentumswohnung) der Großmutter für 120.000 € (und damit nach Auffassung des Klägers weit unter Wert) an eine Bekannte seiner Mutter veräußert hatte. Als Betreuer war der Beklagte zwar grundsätzlich zur Vertretung der Betreuten berechtigt gewesen, doch hätte er für die Verfügung über die Immobilie (als besonders geschützten Wirtschaftsguts) der Genehmigung des Betreuungsgerichts bedurft (§ 1850 BGB neuer Fassung, entsprechend §§ 1908i Abs. 1, 1821 Abs. 1 BGB in der Fassung des Jahres 2015). Weil er für den vorgesehenen Kaufpreis von (nur) 120.000 € kein Gutachten eines vereidigten Immobiliensachverständigen vorlegen konnte, verweigerte das Betreuungsgericht die Erteilung der Genehmigung.
Daraufhin ließ sich der Beklagte von seiner Großmutter selbst eine notariell beurkundete Genehmigung des Wohnungsverkaufs erteilen. Das war grds. möglich, weil seine Großmutter trotz des Betreuungsverhältnisses unstreitig noch geschäftsfähig gewesen war.
In der notariellen Genehmigungsurkunde hieß es unter anderem:
„Den wesentlichen Inhalt des Kaufvertrages hat mir der heute amtierende Notar erklärt. Er hat mich insbesondere darauf hingewiesen, dass das Objekt gemäß § 2 des vorgenannten Vertrages zu einem Kaufpreis von 120.000 € (…) verkauft wird.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass dieser Betrag einer gutachterlichen Stellungnahme des Hausmaklers H. (…) vom 21.12.2015 entspricht. Auch der Inhalt dieser gutachterlichen Stellungnahme wurde mit dem heute amtierenden Notar besprochen.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich die Genehmigung aller Erklärungen, die mein Enkelsohn als gerichtlich bestellter Betreuer für mich im Kaufvertrag (…) abgegeben hat, wobei sich diese Genehmigung insbesondere auf den vereinbarten Kaufpreis von 120.000,00 EUR bezieht. Ein Verkauf der Immobilie zu diesem Preis entspricht meinem hiermit ausdrücklich bestätigten Willen.“
Der klagende Alleinerbe bestreitet nun, dass die Erblasserin tatsächlich ordnungsgemäß von dem Notar über den Inhalt des Kaufvertrags und den Charakter der „gutachterlichen Stellungnahme“ (bei der es sich tatsächlich nur um eine knappe Stellungnahme eines Grundstücksmaklers handelte) aufgeklärt worden wäre. Er beanstandet weiter, dass seiner Großmutter in dem Kaufvertrag als Verkäuferin gegen alle Regel die Tragung der Notarkosten und der Grunderwerbsteuer auferlegt wurde (normalerweise trägt die der Käufer). Außerdem sei bei der Kaufpreisfindung nicht berücksichtigt worden, dass ein zu der Wohnung gehörender Stellplatz mit verkauft worden sei. Über diese Nachteile hätte der Beklagte seine Großmutter informieren und klären müssen, ob sie auch unter solchen Voraussetzungen die Wohnung für nur 120.000 € hätte verkaufen wollen. Ob dies geschehen sei, sei der Notarurkunde nicht zu entnehmen.
Der Beklagte ist dem mit dem Argument entgegengetreten, dass die Notarurkunde doch beweise, dass die Erblasserin vor der Protokollierung ihrer Erklärung ordnungsgemäß über den Kaufvertrag und die gutachterliche Stellungnahme vom Notar unterrichtet worden sei.
Dem waren in den beiden ersten Instanzen das Landgericht Stade und das Oberlandesgericht Celle gefolgt, unter Berufung darauf, dass es sich bei der Notarurkunde um ein Beweismittel im Sinne von § 415 der Zivilprozessordnung (ZPO) handele, das deshalb „vollen Beweis des durch die Urkundsperson beurkundeten Vorgangs“ erbringe.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der BGH hat die Entscheidung des OLG Celle aufgehoben und die Sache zur weiteren Klärung zurückverwiesen. Er hält die Anwendung des § 415 ZPO im vorliegenden Fall für falsch und schreibt dazu in seinem Urteil vom 28.08.2024:
„Die notarielle Urkunde (…) über die Genehmigung des Kaufvertrages ist zwar eine öffentliche Urkunde im Sinne von § 415 Abs. 1 ZPO. Sind solche Urkunden echt und mangelfrei, erbringen sie den vollen Beweis dafür, dass die Erklärung des Urkundsbeteiligten mit dem niedergelegten Inhalt so, wie beurkundet und nicht anders, abgegeben wurde (…). Bewiesen wird die Richtigkeit der Beurkundung, also die Abgabe der Erklärung nach Inhalt und Begleitumständen, auf den Ort und die Zeit der Abgabe der Erklärung sowie auf die Anwesenheit der Urkundsperson (…). Die inhaltliche Richtigkeit der Erklärung ist hingegen nicht von der Beweiskraft erfasst (…). Ob durch die Erklärung über eine Tatsache diese Tatsache selbst bewiesen wird, hat das Gericht im Wege der freien Beweiswürdigung zu entscheiden (…).
Die Rechtsfolge des § 415 Abs. 1 ZPO erstreckt sich im vorliegenden Fall damit (nur) auf die richtige Beurkundung der von der Erblasserin abgegebenen Erklärung, der Notar habe ihr den „wesentlichen Inhalt“ des Kaufvertrags erklärt, sie insbesondere auf den Kaufpreis von 120.000 € hingewiesen und mit ihr den Inhalt der „gutachterlichen Stellungnahme“ besprochen. Verfahrensfehlerhaft ist demgegenüber die Annahme des Berufungsgerichts, es sei bereits aufgrund der Urkunde – unter Ausschluss einer davon abweichenden richterlichen Beweiswürdigung – die Tatsache bewiesen, dass die Erklärung der Erblasserin inhaltlich zutrifft und der Notar mit ihr den Kaufvertrag und die Wertermittlung durch den Immobilienmakler tatsächlich erörtert hat …“.
Der BGH hat damit letztlich nur schlicht und einfach die Formulierung des § 415 Abs. 1 BGB ernst genommen, dass die Urkunde (nur) „vollen Beweis des (…) durch die Urkundsperson beurkundeten Vorganges“ (Unterstreichung von mir hinzugefügt) erbringt. In der Urkunde steht aber eben nur, dass eine bestimmte Person (hier: die verstorbene Großmutter) etwas bestimmtes erklärt hat, nicht auch, ob diese Erklärung inhaltlich richtig oder falsch oder im gegebenen Zusammenhang ausreichend ist (was war hier der „wesentliche Inhalt“ des Kaufvertrags, den der Notar angeblich erklärt haben soll?).
Hinzu kam hier, dass nicht der Notar hinsichtlich der Qualität der „gutachterlichen Stellungnahme“, des mitverkauften Stellplatzes etc. aufklärungspflichtig war, sondern der Beklagte als Betreuer seiner Großmutter, der umfassend zur Wahrung von deren Interessen verpflichtet war. Ob er dem nachgekommen war, lässt sich dem Inhalt der Notarurkunde nicht entnehmen. Der BGH weist vielmehr am Ende seines Urteils darauf hin, dass im Rahmen der freien Beweiswürdigung anderen Beweisangeboten, wie etwa der Vernehmung des an den Beurkundungsverhandlungen beteiligten Rechtsanwalts, hätte nachgegangen werden müssen.
Konsequenzen:
Die Entscheidung zeigt, dass die Beweiswirkung öffentlicher Urkunden im Sinne von § 415 BGB (das sind neben Notarurkunden auch bestimmte behördliche Urkunden) weit weniger reicht als oft vermutet. Bei Erklärungen über eine Tatsache beweist die Urkunde nur, dass die Erklärung als solche abgegeben wurde, nicht aber die Tatsache selbst. Das Vorliegen oder Nichtvorliegen von letzterer muss von den Gerichten vielmehr mit den üblichen Mitteln der Zivilprozessordnung im Wege freier Beweiswürdigung gemäß § 286 ZPO ermittelt werden.
Das bedeutet auch, dass man bei berechtigten Zweifeln an Behauptungen nicht schon wegen des Vorliegens einer Notarurkunde, auf die sich jemand beruft, vorschnell die Flinte ins Korn werfen sollte. Der Fall des BGH zeigt vielmehr, dass es aussichtsreich sein kann, nach sonstigen Beweismitteln Ausschau zu halten.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 5/25
Drucken | Teilen