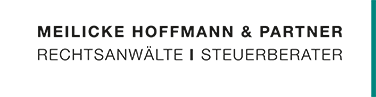Newsletter
Verjährungsfalle bei der Geltendmachung von Abfindungsansprüchen eines Gesellschafters, Voraussetzungen für eine Verjährungshemmung durch Beauftragung eines Gutachters
Gesellschaftern, die aufgrund einer Kündigung ihrer Gesellschafterstellung oder durch einen Einziehungsbeschluss der Gesellschaft aus dieser ausscheiden, stehen grundsätzlich Abfindungsansprüche zu. Häufig finden sich dazu Regelungen in den Gesellschaftsverträgen, etwa auch zur Ermittlung der Abfindungshöhe durch externe Gutachter. Dies kann zu zeitlichen Verzögerungen und bei nachlässiger Vorgehensweise im schlimmsten Fall zur Verjährung der Abfindungsansprüche führen. Diese Gefahr besteht auch in Konstellationen außerhalb des Gesellschaftsrechts, wenn die Anspruchshöhe sachverständig ermittelt werden muss.
Mit einem solchen Fall hat sich das Oberlandesgericht (OLG) München in seinem Urteil vom 26.02.2025, 7 U 7508/22e, befasst und festgestellt, dass die Abfindungsansprüche des klagenden Gesellschafters verjährt waren.
Der Sachverhalt:
Der Kläger war mit 50 % an der Gesellschaft beteiligt, als diese im Jahr 2015 beschloss, seinen Gesellschaftsanteil einzuziehen. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass der ausgeschlossene Gesellschafter in einem solchen Fall als Abfindung eine Einziehungsvergütung erhalten sollte, die zum Ablauf des auf den Ausschließungsbeschluss folgenden Kalenderjahres fällig war, hier also zum 31.12.2016. Zur Ermittlung der Abfindungshöhe war vertraglich vorgeschrieben, dass die Gesellschaft und der von der Einziehung seines Anteils betroffene Gesellschafter dafür gemeinschaftlich einen Wirtschaftsprüfer beauftragen. Sollte über eine solche Beauftragung keine Einigung erzielt werden, solle das Los unter den von der Gesellschaft und dem Gesellschafter vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfern entscheiden. Nach der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren gem. § 195 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), wären die Abfindungsansprüche demnach an sich zum 31.12.2019 verjährt. In den Jahren 2018 und 2019 verhandelte der Gesellschafter aber sieben Monate und vier Tage lang mit der Gesellschaft über die Ansprüche. Solche Verhandlungen hemmen gem. § 203 BGB die Verjährung, so dass die Verhandlungszeit an die Verjährungsfrist „angehängt“ wird. Deshalb lief die Verjährungsfrist hier schließlich am 04.08.2020 ab (diese verjährungstechnischen Details waren dem Gesellschafter seinerzeit nicht bewusst). In den Verhandlungen hatten beide Seiten verschiedene Wirtschaftsprüfer vorgeschlagen, konnten sich aber nicht auf einen einigen. Auf nach dem Scheitern der Verhandlungen seitens des Gesellschafters an die Gesellschaft gerichtete Anwaltsschreiben, mit denen er diese aufforderte, das Losverfahrens zur Auswahl eines Wirtschaftsprüfers zu starten, andernfalls er das selbst tun werde, reagierte diese nicht mehr. Daraufhin veranlasste der Gesellschafter im April 2020 einen Notar mit der Durchführung des Losverfahrens; das Los fiel auf eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Über diese Aktivitäten des Notars und das Ergebnis des Losverfahrens informierte der Gesellschafter die Gesellschaft nicht.
Stattdessen erhob er (erst) im Oktober 2020 eine Klage gegen die Gesellschaft, mit der diese verpflichtet werden solle, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Ermittlung der Abfindungshöhe zu beauftragen, Auskünfte über ihre Jahresabschlüsse und wirtschaftlichen Ergebnisse zu erteilen und anschließend die daraus ermittelte Abfindung zu zahlen. Da die Klageerhebung aber erst rund zwei Monate nach Ablauf der Verjährungsfrist erhoben wurde, kam sie zu spät, die Abfindungsansprüche waren verjährt.
Rechtliche Argumentation des OLG München:
1. Allgemeine Regelung des Laufs der Verjährungsfrist
Zum Lauf der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist (§ 195 BGB) weist das OLG München zunächst auf die Regelung des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB hin, wonach die Frist mit dem Schluss des Jahres zu laufen beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne weiteres hätte erlangen können. Das war hier eindeutig mit Ablauf des 31.12.2016 der Fall, da die Abfindung nach den vertraglichen Regelungen an diesem Tag fällig wurde und der Gesellschafter wusste, dass die Gesellschaft seine Geschäftsanteile eingezogen hatte und dafür eine Abfindung mit Ablauf des auf die Einziehung folgenden Kalenderjahres zahlen musste.
2. Verjährung von Hauptansprüchen und Hilfsansprüchen (u.a. auf Auskunftserteilung) sind grds. unabhängig voneinander zu beurteilen
Des Weiteren stellte das OLG München nochmals klar, dass grundsätzlich Hauptansprüche (hier: Anspruch auf Zahlung der Abfindung) und Hilfsansprüche (hier: Anspruch auf Erteilung von – für die Ermittlung der Abfindungshöhe erforderlichen – Auskünften über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Gesellschaft) unabhängig voneinander verjähren, die Hilfsansprüche aber „gegenstandslos“ werden (also nicht mehr durchsetzbar sind), wenn der Hauptanspruch verjährt ist.
Das ist ein für sich genommen wichtiger Hinweis, da Auskunftsansprüche grds. der allgemeinen dreijährigen Verjährungsfrist unterliegen, für Zahlungsansprüche aber (gesetzlich oder vertraglich) kürzere Verjährungsfristen gelten können. In solchen Fällen kann ein Gläubiger nach Verjährung des Zahlungsanspruchs auch seine Auskunftsansprüche nicht mehr durchsetzen. Im vorliegenden Fall war der Hinweis allerdings gar nicht entscheidungsrelevant, weil hier die Auskunftsansprüche und der Anspruch auf Zahlung der Abfindung derselben Verjährungsfrist unterfielen. Der Hinweis des OLG München ist auch nicht neu, doch ist es gut, die Zusammenhänge noch einmal in Erinnerung zu rufen.
Wichtig ist aber auch, dass selbst eine – rechtzeitige – Klage auf Auskunftserteilung die Verjährung der Abfindungsansprüche nicht gehemmt hätte (dazu hat das OLG nichts gesagt, weil der dortige Kläger eine Auskunftsklage in unverjährter Zeit nicht erhoben hatte). Vielmehr müssen die Zahlungsansprüche selbst gehemmt werden, wenn nicht durch eine direkte Zahlungsklage (weil die Anspruchshöhe noch nicht feststeht), dann doch wenigstens durch eine Klage auf Feststellung des grundsätzlichen Bestehens der Ansprüche oder – das war das Kernthema des Rechtsstreits – durch Klage auf Mitwirkung an dem vereinbarten Begutachtungsverfahren (s. sogleich).
3. Zur Verjährungshemmung durch Einleitung eines Begutachtungsverfahrens gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB reicht es nicht, den Anspruchsgegner zur Mitwirkung aufzufordern
Am interessantesten, weil in der Rechtsprechung in den Details bislang wenig ausgeleuchtet, sind die Ausführungen des OLG München zu den Voraussetzungen für eine Verjährungshemmung durch Einleitung eines Begutachtungsverfahrens gem. § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB.
Hierzu weist das OLG darauf hin, dass bloße Verhandlungen über die Einleitung eines vertraglich vorgesehenen Begutachtungsverfahrens für § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB nicht ausreichen, sondern solche Verhandlungen nur zu einer – in den Konsequenzen, insb. hinsichtlich des Endes der Verjährungshemmung – weniger weitreichenden Verjährungshemmung gem. § 203 BGB führen.
Für § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB sei es vielmehr – entsprechend dem Wortlaut der Vorschrift – erforderlich, dass das Begutachtungsverfahrens beginnt oder bei etwaig abweichenden vertraglichen Vereinbarungen diese eingehalten werden. Im vorliegenden Fall gab es solche Vereinbarungen, nämlich die gemeinschaftliche Beauftragung eines Gutachters. Wenn also beide Seiten das Losverfahren zur Auswahl des Gutachters gestartet hätten, wäre dies nach Auffassung des OLG München für eine Hemmung der Verjährung der Abfindungsansprüche ausreichend gewesen. Das Gericht hat sogar noch erwogen, ob die einseitige Durchführung des Losverfahrens durch nur eine Partei (hier: Gesellschafter) ausreichend sein könnte, wenn dieser Schritt der anderen Seite kommuniziert worden wäre und diese ihm nicht widersprochen hätte. Eine solche Information hatte der Gesellschafter aber unterlassen. Auch wenn es deshalb auf die Hilfserwägung des Gerichts nicht mehr ankam, stellt es klar, dass es eine solche ausweitende Auslegung des § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB nicht für richtig hielte. Es begründet diese Auffassung mit dem nochmaligen Hinweis auf die konkurrierende Hemmungsmöglichkeit durch Verhandlungen gem. § 203 BGB und vor allem damit, dass der Anspruchsteller auch durch diese strikte wortlautgetreue Auslegung des § 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB nicht schutzlos gestellt werde. Denn ihm stehe ja die Möglichkeit offen, den Anspruchsgegner auf die Mitwirkung an dem Begutachtungsverfahren zu verklagen.
Fazit:
In Fällen, in denen die Durchsetzung von Hauptansprüchen, insb. Zahlungsansprüchen, eine vorhergehende gutachterliche Ermittlung der Anspruchshöhe, die Feststellung eines Schadens z.B. durch ein Unfallereignis o.ä. erfordert, kann die Verjährung der Ansprüche bereits durch die Einleitung eines vereinbarten (die Vereinbarung kann in einem Vertrag enthalten sein oder auch später getroffen werden, etwa gem. § 317 BGB) Begutachtungsverfahrens gehemmt werden (§ 204 Abs. 1 Nr. 8 BGB). Diese Einleitung erfordert aber mehr als die Aufforderung der Gegenseite, an der Beauftragung eines Gutachters mitzuwirken oder über diesen Schritt zu verhandeln. Auch die einseitige Auswahl und Beauftragung eines Gutachters reicht nicht (es sei denn, gerade dies wäre so vereinbart, was aber kaum je vorkommen dürfte), ebensowenig die Geltendmachung bloßer Auskunftsansprüche. Vielmehr muss der Gläubiger, wenn die Verjährung seiner Ansprüche droht, die Gegenseite auf Mitwirkung an dem Begutachtungsverfahren verklagen oder wenigstens eine Feststellungsklage erheben.
Es ist daher dringend anzuraten, bei Zahlungsansprüchen, deren Höhe erst noch gutachterlich ermittelt werden muss, nicht zu lange zuzuwarten und auf eine Mitwirkung des Anspruchsgegners nur zu hoffen. Sonst droht die Verjährungsfalle.
In folgendem Newsletter erschienen : Newsletter 6/25
Drucken | Teilen